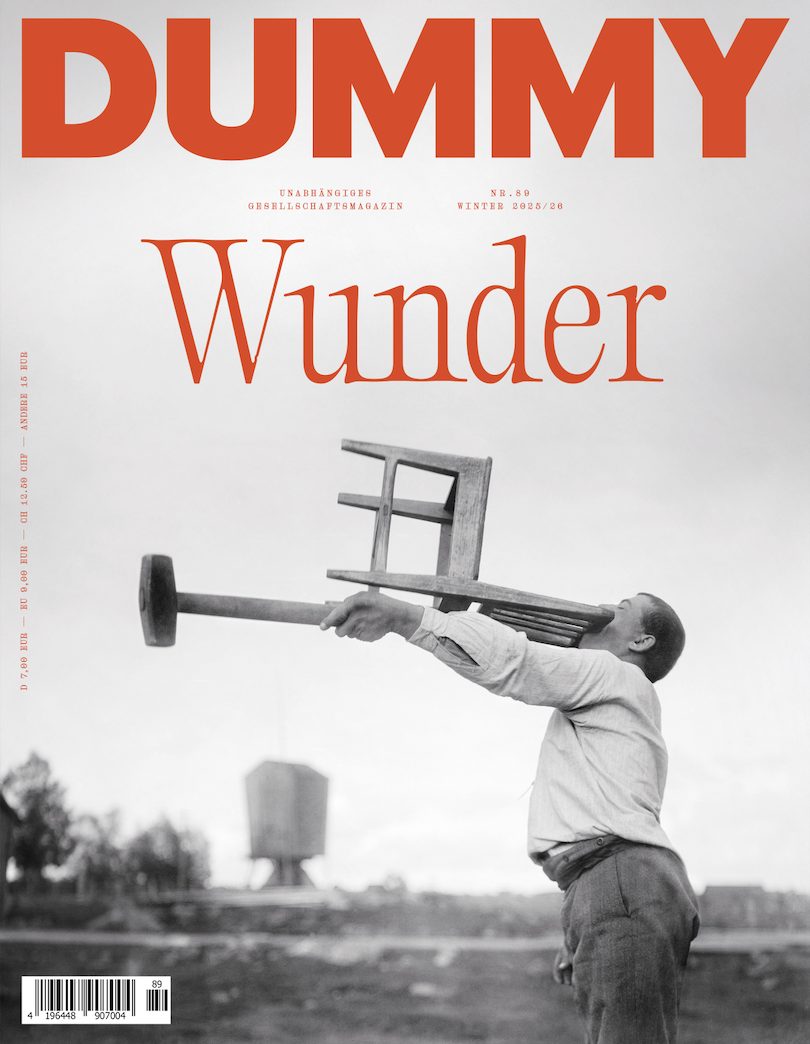Beate Ochmann, 87
Besuch bei einer alten Dame
Von Oliver Gehrs
Das Einzige, was Deutschland noch habe, sagt Frau Ochmann, sei die Gemütlichkeit. Und das muss man sagen: Gemütlich ist es bei Frau Ochmann. Und sauber ist es auch, sehr sogar.
Ihr Wohnzimmer hat sie selbst pastellgelb gestrichen, auf dem gelben Sofa liegen zwei gelbe Kissen, den Wohnzimmertisch ziert eine gelbe Spitzendecke. Auf dem Teller für den Gast liegen drei gelbe Stücke Sandkuchen, der Kaffee kommt aus einer goldenen Thermoskanne. Sonst liegen auf dem Tisch noch ordentlich aufgefächert: diverse Modehauskataloge, Gutscheine verschiedener Versandhandelshäuser, Familienfotos, Diplome, die Frau Ochmann im Laufe ihres 88-jährigen Lebens gemacht hat.
„Ich habe alles schwarz auf weiß“, sagt sie.
Die Wohnung liegt im zehnten Stock eines ziemlich grauen Hochhauses in der Berliner Gropiusstadt, einer Trabantensiedlung mit über 18.000 Wohnungen. Das Straßenbild wird von alten Menschen, Emigranten und Hartzern dominiert, die schon um zwölf vor den niedrigen Kneipen in den Erdgeschossen der Betonklötze sitzen und ordentlich gezapfte Biere trinken. Frau Ochmanns Balkon erkennt man schon von weitem, sie hat ihn gelb angestrichen. Und weil sie im August schon an den nahenden Winter denkt, hat sie die Pflanzen in den Blumenkästen bereits durch Seidenblumen ersetzt. Auch der grüne Sonnenschirm ist bereits ordentlich verstaut.
Frau Ochmann kommt aus gutem Haus, wie sie sagt. Ihr Vater hatte vor dem Krieg in Oberschlesien eine Gurken- und Krautfabrik. Sie hat sich schon früh sehr für das Geschäft interessiert und war das Lieblingskind ihres Vaters. Er besuchte mit ihr Geschäftskunden, Museen oder Synagogen, wofür sie Hebräisch lernte. Mit 17 musste Frau Ochmann die Firma übernehmen, weil ihr Vater früh starb. Nach dem deutschen Einmarsch in Polen hatte er sich öffentlich über Hitler lustig gemacht und wurde dafür so drangsaliert, dass er einen Schlaganfall bekam, von dem er sich nicht mehr erholte.
Bei Kriegsende wurde die Gurkenfabrik und Frau Ochmann erst Kassiererin in einer Gemeinde, dann Buchhalterin im Gesundheitsamt, Hauptbuchhalterin, wie sie sagt. Durch ihren Beruf lernte sie auch ihren Mann kennen, den sie erst gar nicht mochte. Er habe keinen Respekt vor Frauen gehabt, und besonders gebildet sei er auch nicht gewesen. Sie selbst konnte damals schon mehrere Sprachen: Russisch, Polnisch und Deutsch. Weil er aber sehr sauber und ordentlich war, hat sie ihn schließlich doch geheiratet. Und er hatte diesen schönen deutschen Namen: Edward Ochmann.
Die Gropiusstadt ist das, was man einen sozialen Brennpunkt nennt. Es gibt immer mal Ärger, Überfälle, Drogendelikte. Vor ein paar Jahren traf es auch Frau Ochmann. Ein 14-jähriger türkischstämmiger Junge habe sie geboxt und als deutsche Hure beschimpft. „Das durften schon die Russen oder Polen nicht zu mir sagen.“ Weil sie eh immer in einer Art Angriffshaltung stehe, sagt sie, sei sie nicht von der Stelle gewichen. „Ich habe ja den schwarzen Gürtel.“ Die Sache ging dann laut Frau Ochmann so aus, dass sie dem Jungen zwei Zähne ausschlug. Sie trug einen schweren Ring an dem Tag. Seitdem habe sie keinen Ärger mehr mit den Jugendlichen gehabt. Wenn sie davon erzählt, muss Frau Ochmann noch heute kichern. „Ich bin doch viel zu gerissen.“
Seit den 70er-Jahren wohnt sie schon dort. 1971 siedelte sie mit ihrem Mann, ihrem Sohn und ihrer Mutter nach Deutschland um. Erst lebten sie dreieinhalb Jahre im Auffanglager Friedland, dann zogen sie nach Westberlin, Lipschitzallee 146, zehnter Stock. Seit 14 Jahren wohnt sie dort allein, ihr Mann starb an Zucker.
„Der hat dich eh nur ausgenutzt“, habe ihr Sohn gesagt, und da sei schon was dran. Im Grunde habe er nie viel gemacht, vor allem von ihrem Geld gelebt, das sie aus der Textilfabrik mit nach Hause brachte. Handwerkliches Geschick habe er leider auch nicht gehabt. Tapezieren, Malen, Renovieren – das alles hat sie erledigt. „Er hatte leider zwei linke Hände.“
Man denkt es gar nicht, aber Frau Ochmann hat immer sehr viel zu tun. Derzeit kürzt sie gerade ihre Hosen, weil sie immer kleiner wird. 18 Stück hat sie schon gekürzt, 20 kommen noch an die Reihe. Sie schreibt auch viel: Gedichte („Oh Vaterland, oh Vaterland, du gehst unter durch Politikerhand“), vor allem aber Beschwerdebriefe. Einer ging neulich an ARD und ZDF. Darin fragt sie, warum sie Gebühren bezahlen soll, wenn im Fernseher immer nur Flüchtlinge und Islamisten kommen. Und Griechen. Sie sähe gern mal etwas anderes. Ein anderes Schreiben ging an das Modeversandhaus Klingel. Warum es denn in deren Katalogen nicht sechs bis sieben Sonderseiten mit Mode für ältere Damen gebe. Ist ja auch wirklich eine gute Frage. Die Post bekomme bald auch noch eins aufs Dach, sagt sie.
Mode ist für Frau Ochmann sehr wichtig. Sie wirft sich gern in Schale. Und sie trägt gern farblich aufeinander abgestimmte Sachen. Manchmal geht sie ganz in Gelb, manchmal ganz in Flieder oder ganz in Türkis. Vieles näht sie selbst, zum Beispiel eine Pelerine mit Pelzbesatz, die sie aus einem anderen Mantel herausgetrennt hat. „Sehr, sehr elegant“, habe ihr neulich ein Mann aus dem fünften Stock hinterhergerufen, ein Familienvater um die 40, der sie beim nächsten Mal sogar gefragt habe, ob sie mit ihm schlafen würde. „Aus dem Alter bin ich schon lange raus. Da muss der noch zehnmal geboren werden“, sagt Frau Ochmann. Aber schmeichelhaft ist es natürlich schon.
Dass man vom Fußboden essen kann, ist ja meist nur so ein Spruch. Bei Frau Ochmann aber stimmt es ganz bestimmt. Der Laminatboden glänzt, die Arbeitsplatte in der Küche auch. Im Schlafzimmer, wo sogar der Heizkörper rosa gestrichen ist, hängen die Complets fein säuberlich am Schrank. Bügel nach rechts heißt, dass sie es schon mal getragen hat, Bügel nach links bedeutet: frisch. Dieses System hat sich bewährt.
Jeden Mittwoch kommt ihr Sohn, der in einem Hochhaus um die Ecke wohnt, zum Mittagessen. Ihre Enkeltochter kommt auch manchmal, aber Frau Ochmann lässt sie nur rein, wenn sie nicht ganz in Schwarz kommt. „Sie kleidet sich zu sehr nach dem poppigen System“, findet Frau Ochmann. Komisch sei auch, dass ihre Enkelin Koreanisch studiert – sie hätte sie lieber beim BKA gesehen und in der CDU. Und warum dauert das überhaupt so lange mit dem Studium? Vier Jahre schon. „So eine Sprache hat man doch nach einem halben Jahr gelernt.“ Mit ihrer polnischen Schwiegertochter kann sie leider auch nicht viel anfangen, die könne weder richtig Deutsch noch richtig Polnisch. „Was soll ich mit der reden?“
Was gibt es noch zu Frau Ochmann zu sagen?
Sie hat genau ein Buch im Wohnzimmer. „Deutschland schafft sich ab“ von Thilo Sarrazin.
Sie nimmt für ihr Gesicht nur Wasser, nie Creme und ist erstaunlich faltenfrei.
Und wenn sie sich selbst beschreiben soll, sagt sie: „Ich bin eine alte Deutsche.“